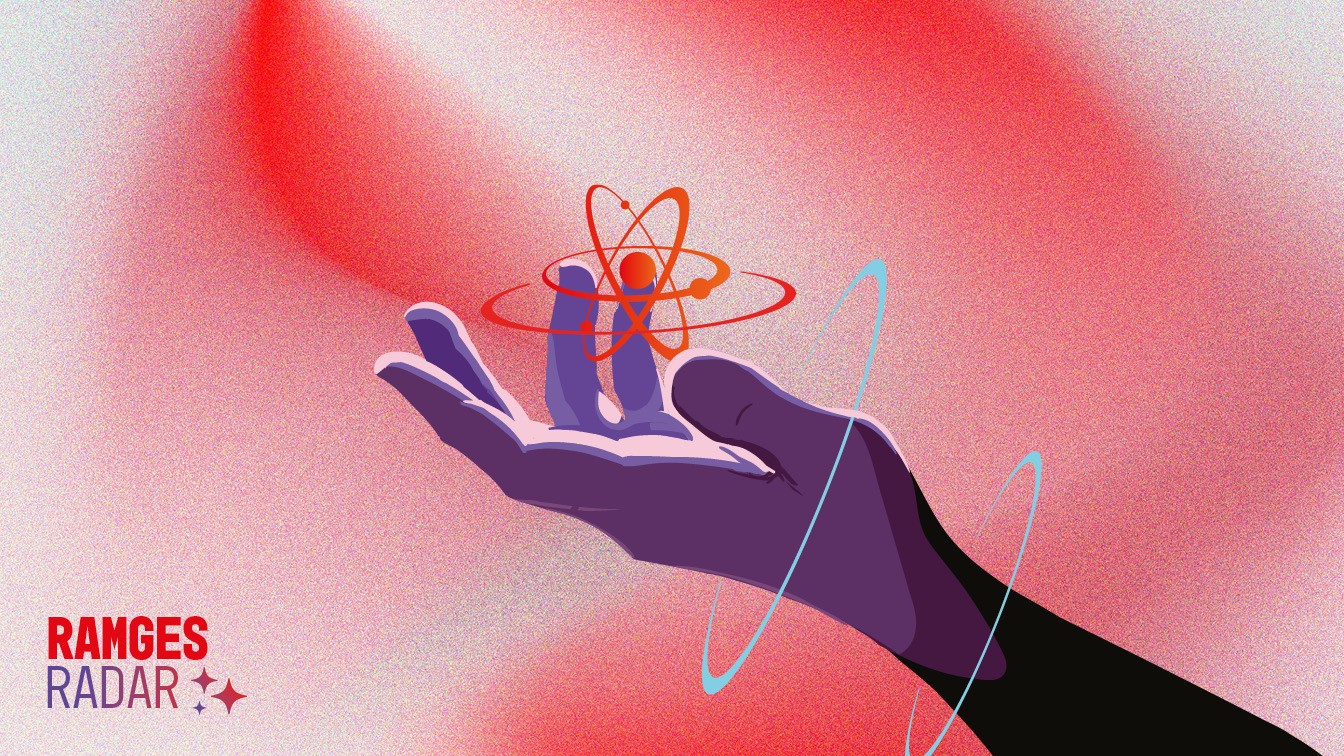Den Bauplan für einen Mini-Fusionsreaktor hat der amerikanische Physiker und Erfinder des Fernsehers Philo Farnsworth im Jahr 1964 entwickelt. Der Farnsworth-Fusor passt tatsächlich auf eine Werkbank. Er hat allerdings einen kleinen, aber entscheidenden Nachteil: Für die Fusion von Atomkernen aus Wasserstoffisotopen mithilfe eines elektrischen Feldes braucht er deutlich mehr Energie, als die Fusionsreaktion dann wieder freisetzt. Verdammt. Und noch blöder: Das Gleiche gilt sechs Jahrzehnte und hunderte Forschungsmilliarden später noch immer, auch für die größten und besten Reaktoren, die bisher entwickelt wurden. (Die angeblich erste Fusion mit Energieüberschuss am kalifornischen NIF im Jahr 2022 war leider schöngerechnet.)
Das heißt: Wir wissen zwar theoretisch, wie uns der physikalische Prozess des Sonnenfeuers auf Erden günstige, saubere, sichere und grundlastfähige Energie im Überfluss liefern könnte. Aber ingenieurstechnisch bekommen wir es einfach nicht hin. Das Plasma, in dem Wasserstoffkerne fusionieren können, ist zu heiß und instabil, zu schwer einzufangen und am Laufen zu halten.
Kernfusion kommt in 25 Jahren. Und das wird immer so bleiben. Der Witz ist fast so alt wie das Konzept von Fusionsreaktoren. In den 2030er-Jahren könnte er sich endlich überholt haben. Drei Trends geben begründeten Anlass zur Hoffnung, dass Kernfusion doch keine „Mission Impossible“ bleibt.
- Technologische Innovationen: Neue Magnet- und Materialtechnologien (z. B. Hochtemperatur-Supraleiter, extrem beständige Wandmaterialien oder innovative Flüssigmetall-Konzepte) ermöglichen stabilere und effizientere Reaktorentwürfe. Mithilfe von KI lässt sich berechnen, wie sich das Plasma verhält. Fortschritte in der Lasertechnologie treiben den Fortschritt in der Kernfusion voran.
- Diversifizierung der Ansätze und internationale Konkurrenz: Fusionsforscher weltweit arbeiten an unterschiedlichen Fusionsprinzipien wie Magnetfusion, Laserfusion oder Inertialfusion. Die Parallelentwicklung und der verstärkte Wettbewerb erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer dieser Ansätze innerhalb der nächsten Jahre zur Marktreife kommen könnte. Auch der geopolitische Wettbewerb belebt das Fusionsgeschäft: China investiert massiv in Fusionsenergie, Die USA sehen sich herausgefordert und Europa möchte diesmal nicht nur hinterherhinken.
- Neue Akteure mit frischem Kapital: Seit den 1960er-Jahren war die Fusionsforschung staatlich bezahlt und organisiert – und bürokratisch. Kluge Köpfe in internationalen Megaprojekten wie ITER kamen in Tippelschritten voran. Heute treibt ein kleines Dutzend hochambitionierter Startups wie Commonwealth Fusion Systems, TAE und Helion die Innovation. In Deutschland sind Proxima Fusion und Marvel Fusion ins Rennen gegangen, in Großbritannien Tokamak Energy. Die Fusion-Startups haben bisher rund zehn Milliarden Dollar eingesammelt, zum großen Teil aus dem Umfeld der kalifornischen Big Techs, die für ihre KI-Serverfarmen billige, saubere, grundlastfähige Energie wollen. Die zeitlichen Zielmarken der technischen Roadmaps für funktionale Prototypen und Vorserienmodelle mit Energieüberschuss lauten jetzt nicht mehr „in 25 Jahren“, sondern 2030, 2032, 2033. Helion hat mit Microsoft gar einen Vertrag geschlossen, bereits 2028 Fusionsenergie zu liefern.
Können die Startups halten, was sie versprechen? Das werden wir erst in fünf oder zehn Jahren wissen. Falls sie es schaffen, öffnet sich eine riesige Tür in die postfossile Welt. Falls nicht, wäre auch das ein Gewinn. Denn dann dürfte der Traum von Kernfusion endgültig ausgeträumt sein und die Fusionsenthusiasten in aller Welt akzeptieren: Das Sonnenfeuer ist nichts für die Erde. Oder allenfalls als interessante Versuchsanordnung für Hobbyphysiker in ihrer Garage.