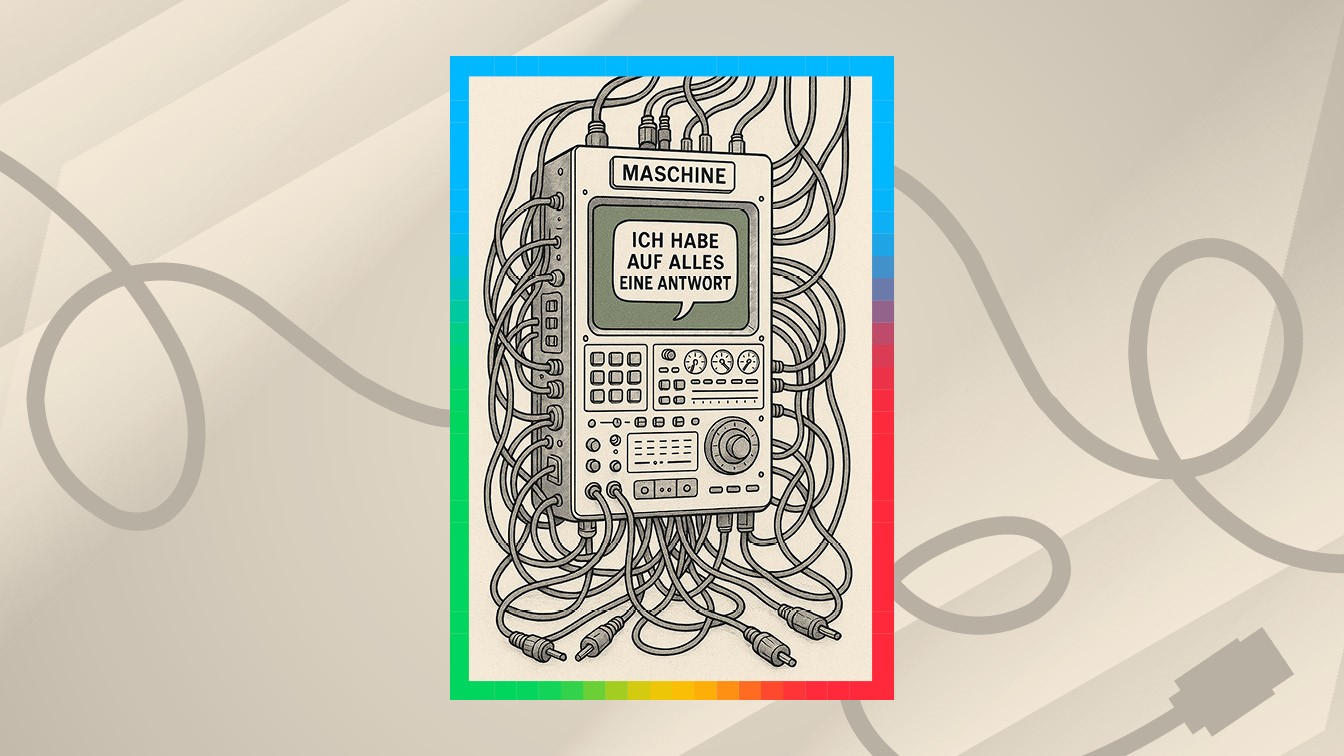Als das Start-up »Perplexity AI« Mitte August ein unverlangtes Übernahmeangebot von 34,5 Milliarden US-Dollar für Googles Browser Chrome abgab, reagierten viele Marktbeobachter mit Erstaunen. Google hat bisher keinerlei Verkaufsabsichten erkennen lassen und die Offerte übersteigt den geschätzten eigenen Wert von Perplexity deutlich. Viele Beobachter bewerten den Vorstoß des dreijährigen KI-Start-ups daher als strategischen PR-Schachzug, um dem eigenen, vor kurzem gelaunchten Browser Comet mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Der Coup nach dem Motto »David kauft Goliaths Keule« fällt in eine Phase, in der sich der Zugang zum Internet grundlegend verändert. Über zwei Jahrzehnte bestimmte Google mit seiner Suchmaschine, welche Informationen Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekamen. Suchergebnisse und Einträge, die nicht weit oben in den Linklisten erschienen, waren faktisch unsichtbar. Dieses Prinzip wird derzeit von generativen KI-Systemen wie ChatGPT, Perplexity oder Googles AI Overviews infrage gestellt. Immer mehr Menschen lassen sich Antworten über KI direkt liefern, anstatt eine klassische Internetsuche zu starten.
Kampf um die Schnittstelle hat längst begonnen
Während Studien diesen grundlegenden Wandel noch analysieren, ist der nächste Umbruch bereits im Gange. Diesmal geht es um die Schnittstelle selbst. Eine neue Generation von Browsern integriert KI-Funktionen direkt in die Oberfläche. Namen wie »Arc«, »Opera Aria«, »Microsoft Edge mit Copilot« oder »Perplexity Comet« stehen für Programme, die nicht nur Webseiten anzeigen, sondern Inhalte kuratieren und filtern. Fachleute rechnen damit, dass diese Entwicklung ähnlich weitreichende Folgen haben könnte wie der sogenannte »Browserkrieg« der 1990er Jahre.
Die Gefahr der Einbahnstraße
Mit der Integration von KI-Antwortsystemen verschiebt sich der Informationskonsum immer stärker in die Oberflächen der Browser. Nutzerinnen und Nutzer erhalten direkt Antworten, ohne die dahinterliegenden Quellen zu besuchen. Für Unternehmen verschärft das die Herausforderung sinkenden Website-Traffics weiter und damit einhergehend generieren sie weniger Werbeeinnahmen, Leads oder Kundenbindung. Wie im FI-Magazin-Artikel »KI ersetzt mehr und mehr die Internetsuche« beschrieben, droht dadurch eine neue Abhängigkeit. Die Macht über Sichtbarkeit und Reichweite konzentriert sich nicht mehr auf Suchmaschinenanbieter, sondern auf eine Handvoll KI-Anbieter. Diese agieren als Gatekeeper mit eigenen, oft intransparenten Auswahlkriterien.
Transparenz und Vielfalt auf dem Prüfstand
Die Intransparenz der KI-Auswahl birgt allerdings Risiken. Welche Perspektiven, Quellen und Stimmen werden in den Antworten berücksichtigt, und welche bleiben außen vor? Eine Verengung der Meinungsvielfalt droht, wenn Systeme Informationen vorfiltern und ihre Kriterien nicht offenlegen. Entscheidend sind nachvollziehbare Kriterien und prüfbare Belege. Von zentraler Wichtigkeit ist die konsequente Auswahl neutraler und verlässlicher Quellen. Für die digitale Öffentlichkeit steht mehr auf dem Spiel als nur ein Ranking. Es geht um die Offenheit und Vielfalt der Informationslandschaft.
Rechtliche und ethische Herausforderungen
Auch rechtliche und ethische Fragen gewinnen an Bedeutung. Wem gehören die generierten Antworten? Wie werden Urheberrechte und Datenschutz gewahrt, wenn KI-Systeme Inhalte neu kombinieren und zusammenfassen? Und wer übernimmt Verantwortung, wenn fehlerhafte oder verzerrte Informationen verbreitet werden? Die Regulierung der neuen KI-Gatekeeper steht noch am Anfang, die gesellschaftlichen Auswirkungen sind kaum absehbar.